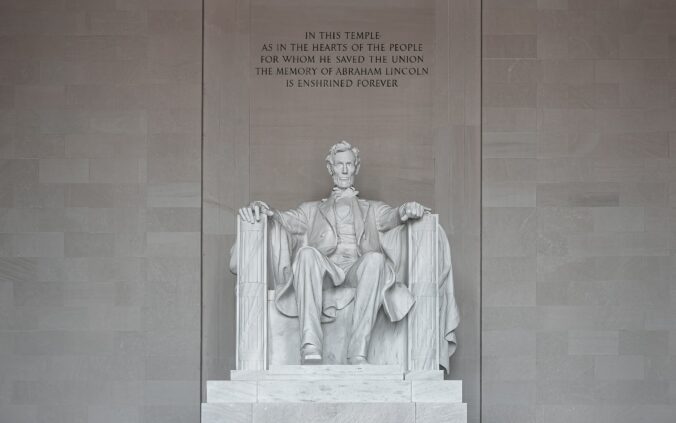Der Begriff Rassismus wird heutzutage schnell und an allen kulturellen Fronten ins Feld geführt. Keiner weiß genau, welcher Begriff noch „sicher“ und welcher schon „rassistisch“ ist. Weißt man beispielsweise darauf hin, dass gewisse Einwanderergruppen im Bereich der Gewaltverbrechen stark überrepräsentiert sind, im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil, so macht man sich schnell zum Rassisten. Gleichzeitig dürften Sie aber, werter Leser, schon mehr als einmal die Behauptung gehört haben, es gäbe keine menschlichen Rassen.
Die Annahme ist also scheinbar, dass das Verhalten der Personen durch die Zugehörigkeit zu einer, ja eigentlich nicht existierenden, Rasse zu begründen ist. Gleichzeitig will uns aber der Zeitgeist weismachen, dass geschlechtsspezifisches Verhalten nur gesellschaftlich, also kulturell, konstruiert wurde. Ist es nun Rasse oder Kultur?
Was meint denn eigentlich der Begriff Rasse?
Wenn man versucht sich dem Begriff Rasse zu nähern, stößt man zuerst an mehr als nur einer Stelle auf die Aussage: „Es gibt keine menschlichen Rassen.“ Was fangen wir nun damit an? Mit Rasse, z.B. in Bezug auf Hunde meint man phänotypische (erkennbare) Merkmale. Also Fell, Kopfform, Größe, Farbe und allgemeiner Wuchs. Ebenso ist es bei Pferden. Und wie ist das beim Menschen? Es dürfte jedem sofort klar sein, dass es Unterschiede im Phänotyp gibt, bei Personen, die aus unterschiedlichen Gebieten kommen.
Der wissenschaftlich korrekte Terminus wäre übrigens die Unterart, die wie folgt definiert ist (nach Herrn Ernst Mayr):
„Eine Subspezies(Unterart, Anm.d.Red.) ist die Zusammenfassung phänotypisch ähnlicher Populationen einer Art, die ein geographisches Teilgebiet des Areals der Art bewohnen und sich taxonomisch von anderen Populationen der Art unterscheiden.“ (Quelle)
Wie äußert sich nun aber dieser Unterschied? Als Erstes ist die Hautfarbe ein offensichtliches Merkmal. Menschen aus Regionen mit einer höheren Sonneneinstrahlung haben eine dunklere Hautfarbe und Menschen aus sonnenärmeren Gebieten haben eine hellere Haut. Soweit so uninteressant.
Über die Hautfarbe hinaus gibt es aber noch andere Merkmale, die scheinbar stark von der genetischen Herkunft abhängen. Obwohl die Hautfarbe sehr ähnlich ist, unterscheiden sich ein Äthiopier, ein Nigerianer, ein Inder und eine Aborigine den typischen Gesichtszügen, oder dem typischen Körperwuchs nach. Jetzt dürfte sich bei dem ein oder anderen Leser ein ungutes Gefühl im Bauch melden. Darf man das schreiben, dass Menschen aufgrund ihrer Abstammung unterschiedlich sind?
Ich hebe das Ganze kurz auf eine andere Ebene, um diese Frage zu beantworten.
Die Haarfarbe.
Es ist jedem klar, dass gewisse Haarfarben in gewissen Bevölkerungsgruppen nicht vorkommen. Japaner haben eben keine roten Locken und Iren kein schwarzes Kraushaar. Darf man das sagen? Klar, ich glaube, dabei hat kaum einer ein komisches Gefühl im Bauch. Es spielt nämlich keine Rolle, welche Haarfarbe man hat.
Mit der Hautfarbe halte ich es ebenso. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe man hat. Aber die Hautfarben sind eben, genauso wie die Haarfarben, unterschiedlich. Meiner Meinung nach sollte es auch ebenso akzeptiert sein über Hautfarben zu sprechen wie über Haarfarben. Nur die Vorstellung, dass es eben doch eine Rolle spielen könnte, macht dieses ungute Gefühl. Befreien wir uns also davon und sprechen wie Erwachsene über offensichtliche Dinge.
Vielleicht noch ein kurzer Einwurf. Es könnte sich das Argument aufdrängen, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe herabgewertet wurden. Ja, das ist richtig. Das trifft aber auch auf andere Merkmale zu. Rothaarige Menschen wurden lange Zeit als Außenseiter behandelt und werden es immer noch (z.B. hier, hier oder hier). Der Vergleich ist also nicht so weit hergeholt wie es scheinen mag.
Wo waren wir? Ach ja, bei weiteren unterschiedlichen Merkmalen über die Hautfarbe hinaus. Aus meiner Kindheit und Jugend ist noch ein Brettspiel erhalten, das ich hier gerne anführen würde. Café International. Vergeben wir dem Spiel den Fehler, den viele andere auch machen, nämlich Afrika als Land zu betrachten. In dem Spiel geht es darum, Menschen aus unterschiedlichen Nationen in ein Café zu setzten, nach bestimmten Regeln. Worauf ich hinaus möchte, sind die Zeichnungen der unterschiedlichen Nationen.

Natürlich wird hier ein Klischee bedient. Der Italiener sieht eben aus, wie man sich einen Klischeeitaliener vorstellt. Sehen alle Italiener so aus? Nein, sicher nicht. Dennoch kennen wir viele Menschen, die eben sehr typisch aussehen für ihr Land oder ihre Abstammung. Es gibt Gesichtszüge, die sehr slawisch, französisch, englisch oder italienisch sind.
Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Menschen, die sich seit Jahrtausenden einen mehr oder minder begrenzten Genpool teilen, gewisse äußere Merkmale haben (können), die man als typisch für diese Gruppe (oder Rasse oder Ethnie oder Volk) bezeichnen kann. Dabei gibt es durchaus Unterschiede, wie stark der Genpool einzelner Gegenden vermischt wurde. Afrika hat eine viel größere Diversität zwischen den einzelnen Völkern als Europa. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Afrika durch starke geografische Barrieren geprägt ist, die einen Austausch von Genen über die Jahrtausende verhinderten.
Und wie sieht es mit der Kultur aus?
Wie sieht es aber mit dem Begriff Kultur aus, was meinen wir damit und wie können wir uns dieser Idee nähern? Im Ursprung kommt das Wort vom lateinischen Verbum „colere“, welches mit bebauen, pflegen, urbar machen und ausbilden übersetzt werden kann. Von Beginn an meinte man damit sowohl die Kultivierung von Land, oder noch abstrakter der Natur (die den unveränderten Gegenpol zur Kultur darstellt), als auch die geistige „Bebauung“ oder Pflege der geistigen Güter.
Grundsatz einer Kultur, wie der allgemeine Volksmund sie heute wohl versteht, ist eine gemeinsame Sprache. Jeder Sprache wohnen aber auch die ersten gemeinsamen Ideen und Regeln inne. Wie begrüßt man sich? Wie zählt man in der Sprache? Welche unterschiedlichen Anreden sind gebräuchlich? Welche Redewendungen sind gebräuchlich? Welche ideenbeschreibenden Worte gibt es in dieser Sprache, die es in anderen Sprachen nicht gibt? Was gilt als besonders höflich und was bereits als unhöflich?
Der titelgebende Zeitgeist ist eine Idee der deutschen Sprache und wird in anderen Sprachen verwendet (im Englischen z.B.). Auch Worte wie Doppelgänger, Angst oder Gestalt leihen sich die Angelsachsen. Nach der Sprache kommen dann schon die Dinge, die Eltern ihren Kindern mit den Worten „das macht man nicht“, oder „das macht man so“ vermitteln, und oft nach zwei bis drei „warum“ Fragen des wissbegierigen Nachwuchses ohne Antwort da stehen. Die ersten Regeln und Gepflogenheiten.
Auf diesen Regeln bauen dann festere Verpflichtungen auf, die in der Gesellschaft vorherrschen bis zur obersten normativen Ebene, den Gesetzen. Dann gibt es noch die Frage nach der Schönheit, deren Antwort die Kunst versucht zu geben. Auch hier unterscheiden sich Kulturen voneinander. Teil dieser Kunst, aber auch Teil der vorherrschenden Regeln und Verhaltensweisen, ist auch die Mode. Daneben gibt es dann noch Kulinarik und übliche Freizeitvorlieben.
Fassen wir also kurz zusammen, was Kultur im allgemeinen Verständnis meint: Die Sprache, Regeln, Verhaltensweisen, künstlerischen Vorlieben, Mode, Küche und Freizeitvorlieben, die sich eine, meist geografisch beschränkte, Gruppe an Menschen teilt.
Jetzt zum Komperativ, dem Vergleich, bei Rassen und Kulturen
Was machen wir nun mit unserer schönen begrifflichen Annäherung an die Ideen von Rasse und Kultur? Natürlich machen wir einen Vergleich auf. Vor zweihundert Jahren ging man im wissenschaftlichen Umfeld davon aus, dass Rassen einen Einfluss auf Kultur, speziell Werte und Gepflogenheiten haben und, dass sich darauf basierend eine Rangfolge von höherwertigen Rassen und geringerwertigen Rassen formulieren kann. Die Rassenlehre, die ihren Ursprung zum Teil im philosophischen Aufeinandertreffen von individuellen Rechten und Sklaverei hatte.
Die Rassenlehre erwies sich als komplett falsch. Leider leitete sich vor dieser Erkenntnis der Rassismus, also eine politische Idee, aus der Rassenlehre ab. Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen wurde die Idee entwickelt, dass es zum Kampf der Rassen um diese Ressourcen kommen würde (eine Art globaler Sozialismus, der im Kleinen ja nur den Klassenkampf beschwört). Der nationale Sozialismus versuchte diesem Problem zu begegnen, mit grauenhaften Konsequenzen (wie immer bei den unterschiedlichenSozialismen…).
Anders als bei der Rasse können wir schnell zeigen, dass es Kulturen gibt, die „besser“ sind als andere. Dazu müssen wir aber kurz das „besser“ genauer betrachten. Ich bringe schon meinen Kindern, sehr zu deren Unzufriedenheit bei, dass wir eine Frage nach dem „Besser“ nur unter festen Kriterien beantworten können. Ist es besser, ein Schnitzel oder einen Salat zu essen? Nun, unter der Kategorie „Kalorien sparen, um abzunehmen“ wohl der Salat, unter der Kategorie „schnell viele Nährstoffe zu sich nehmen“ wohl das Schnitzel.
Was heißt also „besser“ in Bezug auf Kultur? Meist meinen wir damit wohl Kulturen, in denen sich Individuen ohne äußeren Zwang entfalten können. Zugegeben, das ist eine westliche Sicht auf die Dinge, aber ich bin nun mal ein Mann des Westens. Vor dem Kriterium können wir aber klar Kulturen ausmachen, die schlechter sind als andere. Ich nehme einfach ein krasses Beispiel, um das zu verdeutlichen: Eine Kultur, in der Homosexuelle als Verbrecher verurteilt und an Baukränen aufgehängt werden, ist schlechter (was zwanglose Entfaltung angeht) als eine Kultur, in der Homosexuelle in der Öffentlichkeit sichtbar Zärtlichkeiten (Damit meine nichts, was über Bussi oder Händchenhalten hinausgeht) austauschen können, ohne Aufsehen zu erregen.
Natürlich kann man meine Prämisse der „zwanglosen Entfaltung“ angreifen. Das werde ich sicher an anderer Stelle auch nochmal aufgreifen. Dann steigen wir aber in die Tiefen der Moralphilosophie ab. Das hat durchaus seinen Reiz, führt aber an der Stelle zu weit. Bleiben wir also vorerst bei der Prämisse, um die Überlegung nach dem „Besser“ weiter verfolgen zu können.
Jeder Kultur wohnt eine Vorstellung davon inne, was gut ist. Genauer gesagt könnte man in jeder Kultur ein Ideal formulieren, dem man sich annähert, wenn man ein besonders vollkommener Vertreter der jeweiligen kulturellen Werte ist oder sein will. Vor dieser Annahme gibt es aus der Sicht einer jeden Kultur ein „Besser“ oder „Schlechter“ im Bezug auf andere Kulturen. Simpel ausgedrückt geht es dabei darum, wie gut die kulturellen Werte der einen Kultur auch von den kulturellen Werten der anderen Kultur vertreten werden.
Das ist übrigens unabhängig von der genetischen Herkunft möglich. Ich erinnere mich noch an die Dokumentation zur WM 2010 in Deutschland, in der Spieler scherzhaft darauf hinwiesen, das David Odonkor der deutscheste von ihnen wäre und sie ihn deswegen ab und an „Helmut“ nannten. Auch aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich Personen die eindeutig nichtdeutscher genetischer Abstammung sind, aber kulturell deutlich deutscher als ich, also deutlich näher am Ideal (positiv formuliert) oder Klischee (eher weniger positiv formuliert) des Deutschen sind.
Sicherlich gibt es dabei Werte, die für ein Zusammenleben weniger kritisch sind. Ob jetzt eine gewisse Unpünktlichkeit intolerabel oder Ausdruck der persönlichen Freiheit ist, wird zwar nicht ohne Bedeutung für das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen sein, jedoch nicht zu Bürgerkriegen führen. Bei der Frage, ob Frauen wählen dürfen oder sich ohne männlichen Vormund im öffentlichen Leben bewegen dürfen, tritt schon ein größeres Streitpotential zu Tage.
Im aktuellen Diskurs werden die Begriffe Rasse und Kultur immer wieder durcheinander gewürfelt. Man geht in diversen Wissenschaften sogar von einem Rassismus der Kulturen aus. Es ist aus meiner Sicht unerlässlich die Begriffe sauber zu trennen. Schon alleine deswegen, da man sich für eine Kultur entscheiden, aber die eigene „Rasse“ nicht ändern kann. Ein Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen ist nur dann friedlich möglich, wenn die Ideale dieser Kulturen einen gewissen Deckungsbereich im Kern, also bei den entscheidenden Werten haben. Kulturen, die im Kern keine Gemeinsamkeiten haben, werden nur unter großen gesellschaftlichen Reibereien und mit ständigem Konfliktpotential zusammenleben können.