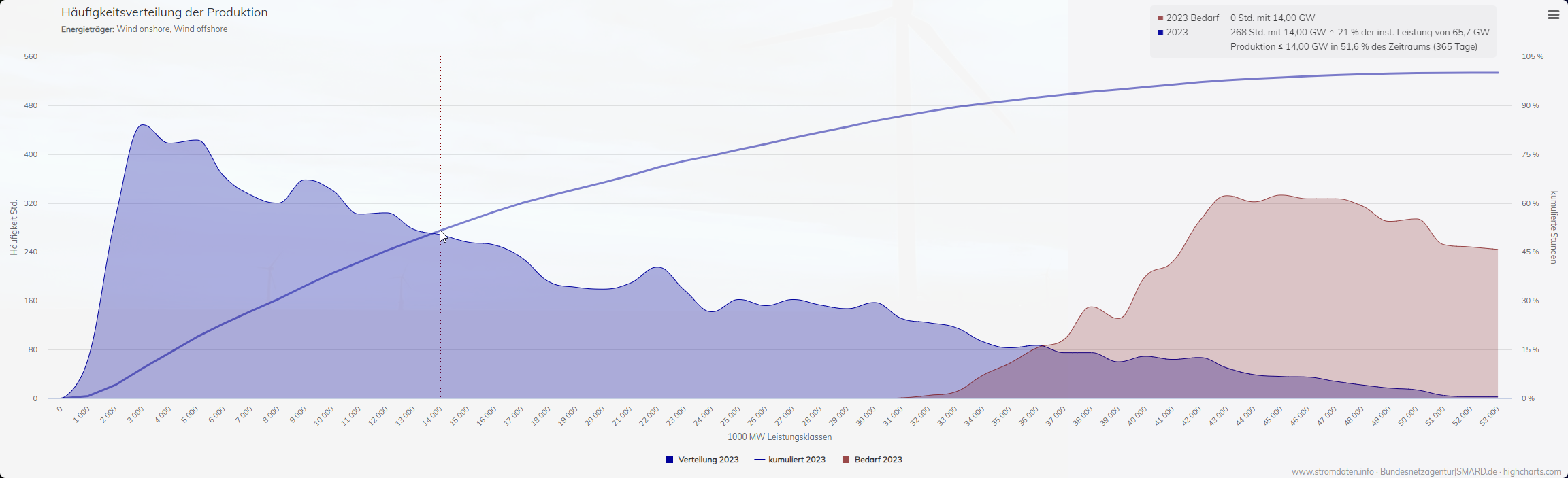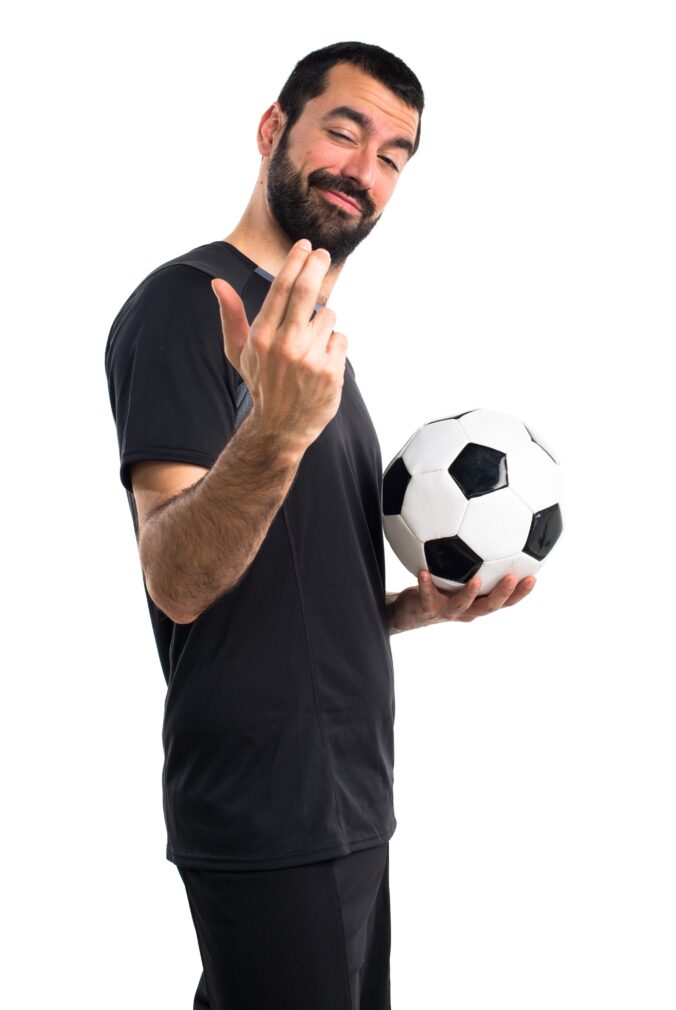Wie ich sicher an der ein oder anderen Stelle schon einmal erwähnt habe, begeistern mich Geschichten in den unterschiedlichsten Medien. Eine Geschichte, die keinen kleinen Einfluss auf mein Leben hatte, wird in dem Spiel Bioshock erzählt. Der Protagonist stürzt mit dem Flugzeug über dem Atlantik ab und überlebt. Im Meer schwimmend sieht er einen Leuchtturm, in dem ein Aufzug ihn in eine seltsame, post kataklysmische Unterwasserwelt führt. Von einem Unbekannten wird er über Funk durch diese Welt geleitet. Die entscheidende Wendung der Geschichte ist, dass man von der Person über Funk manipuliert wurde. Mit einem verborgenen Code wurden die Handlungen bestimmt. Der Protagonist hatte keine andere Wahl, als so zu handeln. Er hatte keinen freien Willen.
Freier Wille vs Determinismus
Damit wären wir auch schon bei dem Konzept, dem ich mich in diesem Artikel etwas genauer nähern wollte: dem freien Willen. Ich möchte mich diesem Thema auf praktischer und weniger auf hoch philosophischer Ebene nähern. Die Frage, ob es ihn nun gibt oder nicht, den freien Willen, treibt die Philosophie schon lange um. Eine endgültige Antwort hätte einen tatsächlichen Einfluss auf unseren Alltag. Die Alternative zum freien Willen nennt man Determinismus und sie beschreibt, dass wir nicht über unser Handeln bestimmen können, sondern all unsere Handlungen vorherbestimmt sind und wir uns nicht anders entscheiden können.
Der Determinismus folgt aus der wissenschaftlichen Betrachtung der Natur. Wir beobachten, dass in der Natur nicht passiert, ohne dass es dafür einen Auslöser gibt. Speziell unter stark wissenschaftlich geprägten Personen ist die Anschauung verbreitet, dass sich dieses Prinzip des Determinismus auch auf menschliche Handlungen bezieht. Grund für unser Handeln ist also nicht unser Wille, sondern ein von uns unabhängiger Auslöser.
In einem Interview mit dem berühmten Biologen Richard Dawkins stellte ihm einer der beiden Moderatoren, Konstantin Kisin, die Frage, ob es nicht seltsam sei, dass wir bei unserem zeitgenössisch stark wissenschaftlich geprägten Weltbild, welches den freien Willen scheinbar widerlegt, unser alltägliches Leben so gestalten, als hätten wir ihn doch, den freien Willen. Also wir leben entgegen den scheinbaren Erkenntnissen unserer Weltanschauung.
Dawkins antwortet sehr respektabel darauf mit, ich weiß es nicht. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass eine solche Antwort, Dawkins führt das natürlich noch weiter aus und geht auf ein paar Punkte ein, an denen man mit seinen Nachforschungen ansetzen könnte, also die Antwort, ich weiß es nicht, immer Respekt verdient. Sie zeugt von Selbsterkenntnis und Selbstsicherheit.
Wie frei darf der Will sein?
Persönlich habe ich so meine Probleme mit der Frage, ob es einen freien Willen gibt. Betrachtet man diese Frage genauer, so fällt vor allem das Wort frei ins Auge. Wovon sollte der Wille frei sein? Im Ursprung von einem äußeren Zwang natürlich. Denkt man genauer darüber nach, sind wir uns schnell einig, dass der Wille nicht frei ist und es auch nicht sein sollte, zumindest nicht im eigentlichen Sinn.
Keiner wünscht sich einen Willen, der frei ist von den eigenen Präferenzen, der eigenen Vergangenheit, dem Temperament und den akzeptierten und für positiv empfundenen Restriktionen. Ein solcher Wille wäre der reine Zufall und kann nicht im Sinne des Anwenders sein. Uns ist klar, dass ein freier Wille immer noch der eigenen Vergangenheit und der eignen Person unterliegt. Mein Wille ist nicht so frei, und soll es auch nicht sein, dass ich auf einmal, grundlos etwas will, dass ich soeben noch nicht wollte.
Die eigentliche Debatte tobt zwischen dem freien Willen und dem Determinismus. Damit sind wir auch wieder bei Dawkins und dem wissenschaftlichen Weltbild. In der Naturwissenschaft beobachten wir nahezu ausschließlich Vorgänge, die determiniert sind. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Nichts geschieht ohne Auslöser. Und hätten wir nur alle notwendigen Daten und die notwendige Mathematik, so könnten wir den Verlauf der Zeit berechnen. Wir könnten mit den vollständigen Daten, alles vorherbestimmen, da ja alles aus dem bereits geschehenen folgt.
Die Annahme von diesem wissenschaftlichen Weltbild und seinen prominenten Vertreter wie Sam Harris, Richard Dawkins oder Yuval Noah Harari ist, dass die Handlungen von Menschen ebenfalls determiniert sind. Also wir, bei vollständigem Wissen über alle relevanten Daten, genau berechnen könnten, was ich als Nächstes schreibe, tue oder denke. Der freie Wille, oder unsere Selbstwahrnehmung als ein, unter den obigen Einschränkungen, von äußeren Zwängen freier Akteur, ist demnach nur eine Illusion. Eine mächtige Illusion, wie Dawkins in dem oben erwähnten Interview anführt, aber dennoch nur eine Illusion.
Das Libet Experiment
Diese Illusionsannahme stützt sich auf ein prominentes Experiment. Das sogenannte Libet Experiment, Ende der 70er Jahre, benannt nach dem amerikanischen Wissenschaftler Dr. Benjamin Libet. Das Experiment fußt auf der Arbeit von den Doktoren Hans Helmut Kornhuber und Lüder Deecke. Diese hatten im Gehirn, Mitte der 60er Jahre, eine spezielle „Welle“ entdeckt, die unmittelbar vor einer Entscheidung anzusteigen schien. Diese nannten sie das Bereitschaftspotential.
Die Idee des Bereitschaftspotentials war, dass sie den Prozess sichtbar macht, der das Bewusstsein auf eine Entscheidung vorbereitet. Ein solche Entscheidung könnte zum Beispiel die spontane Bewegung eines Armes sein. Im Determinismus würde diese Entscheidung durch einen äußeren Einfluss vorherbestimmt oder determiniert sein. Wir hätten nicht die Möglichkeit uns gegen die Bewegung des Arms zu entscheiden, auch wenn wir es anders empfinden, so die Annahme.
Dr. Libet hatte sein Experiment wie folgt aufgebaut. Der Proband saß und blicke auf eine oszillierende Uhr. Sobald er den Drang verspürte, betätigte er einen Schalter. Dabei merkte er sich die Position der oszillierenden Uhr. In einem Vorexperiment konnte die Abweichung bei der Zeitmessung mit 50 ms als hinlänglich genau bestimmt werden. So wurde also aufgezeichnet, wann der Proband den Willen verspürte und diesen in eine Handlung, das Betätigen des Schalters, umwandelte. Parallel dazu wurden die Hirnströme gemessen, um den zeitlichen Verlauf des Bereitschaftspotentials zu ermitteln.
Bei der Auswertung wurde der, mittels EMG (Elektromyografie) gemessene, Beginn der Muskelaktivität als Nullpunkt gesetzt. Dr. Libet interessierte, wie viel Zeit vor diesem Beginn der Muskelaktivität das Bereitschaftspotential anstiegt und wie viel Zeit vorher der bewusste Wille nach dem Drücken lag. Die Erkenntnis war, dass das Bereitschaftspotential ca. 500 ms vor der Handlung anstieg. Der Drang den Schalter zu drücken erfolgte allerdings erst 150 ms vor der Muskelaktivität.
Die Folgerung aus diesem Experiment waren bestimmend für den Diskurs Freier Wille vs. Determinismus der nächsten Jahrzehnte. Zentrrale Erkenntnis war, dass das Gehirn bereits die Bereitschaft zur Handlung anlegt, bevor wir den Drang verspüren und somit eine bewusste Entscheidung zum Handeln vollziehen. Die Schlussfolgerung, über die man auch heute noch häufig stolpert, war, dass unser Gehirn uns die freie Entscheidung nur vorspielt und schon Millisekunden davor die Handlung angelegt wird. Scheinbar ohne unser bewusstes Zutun. Das Gehirn entscheidet also, ohne seinen Besitzer, zu handeln, so die Interpretation des Ergebnisses.
Hat uns die Wissenschaft also endlich eine Lösung der Debatte beschert? Sind wir gar nicht der Herr über unsere Handlungen, sondern nur Opfer der Illusion einer autarken Entscheidung? Leider nein, oder Gott sei Dank möchte ich anmerken. Ich werfe an dieser Stelle ein, dass ich eher gewillt bin an einen freien Willen zu glauben. So können Sie, werter Leser, diese Zeilen auch besser einordnen, da sie meine Position, oder unfreundlicher, Voreingenommenheit nun kennen. Vor dem Hintergrund meiner eigenen Position berichte ich dennoch, so objektive es mir eben möglich ist.
Neue Ergebnisse
2010 hatte ein Herr Dr. Schurger eine Erkenntnis. Bei dem Beobachten der Hirnwellen stellte er ein rein zufälliges auf und ab fest, wie bei Wellen im Ozean. Wenn man jedoch dieses Rauschen nach seinen Hochpunkten ordnen und rückwärts mitteln würde, so entstünde das Bild eines ansteigenden Trends, ohne, dass es dafür eine wirkliche Ursache gibt. Genau das hatten aber die Herrn Doktoren Hans Helmut Kornhuber und Lüder Deecke bei ihrem Bereitschaftspotential getan. Dr. Schurger unterzog also das spontane Grundrauschen des Gehirns der gleichen Auswertungsmethodik von Dr. Kornhuber und Dr. Deecke und fand ein Muster, das aussah wie das Bereitschaftspotential.
Für eine Entscheidung im Gehirn müssen mehrere Neuronen zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommen, simpel gesprochen. Sehen wir viele Schneeflocken und beobachten wir die Richtung ihrer Bewegung, so kommen wir zu der Erkenntnis, dass der Schnee nach unten fällt. Meist sind wahrgenommene visuelle Reize oder andere äußere Eindrücke, Grundlage oder Auslöser einer Entscheidung und somit einer Handlung. Passiert nichts, tun wir nichts, könnte man sagen. In Dr. Libets Experiment gab es aber keine äußeren Eindrücke, nach denen eine Entscheidung getroffen werden konnte. Es mussten, so zu sagen, zufällig mehrere Neuronen übereinstimmen, um die Handlung auszulösen.
Dr. Schurer stellte den Versuch von Dr. Libet nach. Er erweiterte den Aufbau aber um eine Kontrollgruppe, die nichts tun sollte. Eine künstliche Intelligenz wurde genutzt, um zu ermitteln, zu welchem Zeitpunkt sich die Gehirnwellen der nicht handelnden und handelnden Probanden unterschieden. Sollte Dr. Libet mit seiner Schlussfolgerung richtig liegen, und die Entscheidung zum Handeln ohne unser Zutun stattfinden, so müssten sich die Wellen ca. 500 ms vor der Messung der Muskelaktivität unterscheiden. Der ermittelte Unterschied lag aber bei ca. 150 ms vor der Handlung, also genau in dem Bereich, in dem auch im Dr. Libets Experiment die Probanden eine bewusste Entscheidung zur Bewegung trafen.
Dr. Libets Erkenntnis und die scheinbare Lösung der Frage frei oder nicht frei gilt seitdem als widerlegt. Die Neurowissenschaft hat uns nicht aus der Patsche geholfen. Heißt das nun aber, dass es einen freien Willen gibt. Nun, leider auch das nicht zwingend. Zumal ein wirklich freier, also zufälliger Wille, ja auch keine wünschenswerte Erkenntnis ist.
Freier Wille und MacIntyres Unvorhersagbarkeiten
Ich möchte Sie noch mit Gedanken und Argumenten aus der Philosophie konfrontieren, die wenig bekannt sind. Alistair MacIntyre hat vier zentrale Punkte herausgearbeitet (hier kurz in einem Video dargelegt), mit denen er gezeigt haben möchte, dass ein starker Determinismus vom Tisch ist. Genauer, vier Unvorhersagbarkeiten. Dem Determinismus folgend, und ich mag mich hier bei der Dartstellung täuschen oder zu ungenau sein, ließen sich unsere Gedanken und Handlungen vorherbestimmen, wenn wir nur alle relevanten Daten kennen würden. Hätten wir ein komplettes Wissen über die Daten bzw. Aktionen, so könnten wir die Handlungen bzw. Reaktionen vorherbestimmt. Menschliches Verhalten wäre damit zu 100 % Genauigkeit vorhersagbar (der sogenannte starke Determinismus).
Laut MacIntyre ist dies logisch unmöglich. Sein erster Punkt, oder die erste Unvorhersagbarkeit ist, die von konkreten Konzepten oder Ideen. Stellen Sie sich drei Steinzeitmenschen vor. Der erste sagt: „In zehn Jahren werden wir das Rad erfinden“, der zweite fragt berechtigterweise: „Was ist ein Rad?“, woraufhin der dritte in allen Details erklärt, was ein Rad ist. Damit ist das Rad aber schon erfunden. Die Entwicklung komplexer Konzepte ist nicht vorhersagbar, da die Vorhersage bereits das Konzept umfassen würde.
Die zweite Unvohersagbeitkeit ist, dass wir nicht wissen können, was wir als Nächstes denken. Unsere zukünftigen Gedanken sind in unserem Gehirn nicht vorhanden, wären sie es, so wären sie unsere jetzigen Gedanken. Daraus folgt auch gleich seine dritte Unvorhersagbarkeit. Der Spieltheorie folgend ist es nicht möglich, den Ausgang eines Spiels mit mehreren unabhängig voneinander handelnden Akteuren mit unterschiedlichen Interessen genau vorherzusagen. Da keiner der Akteure seine zukünftigen Gedanken und Handlungen kennt, kann er auch unmöglich die zukünftigen Handlungen und Gedanken der anderen Spieler kennen.
Die letzte Unvorhersagbarkeit MacIntyres ist die Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse. Wir wissen nicht, wie wir auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren werden. Paris konnte nicht wissen, dass Helenas Aussehen seine Aktionen auf die Art beeinflussen würden, dass er einen Jahrzehnte langen Krieg auslösen würde. Diesen vier Unvorhersagbarkeiten folgend, kann menschliches Verhalten logisch nicht vorhergesagt werden, und damit ist ein starker Determinismus vom Tisch, argumentiert MacIntyre.
So, und was machen wir nun praktisch mit unseren Erkenntnissen?
Für den Autoren scheint festzustehen, dass der freie Wille nicht widerlegt ist und dass ein starker Determinismus schwer mit der wahrgenommenen Welt in Einklang gebracht werden kann. Ein Leben der Annahme folgend, dass wir, basierend auf unserer Person, Präferenz und vergangener Prägung, frei Entscheidungen treffen können und für diese Entscheidungen Verantwortung tragen, erscheint ihm daher sehr sinnvoll. Und selbst Dawkins, ein klarer Anhänger des Determinismus, gesteht ein, dass er auf genau diese Art und Weise seinen Alltag gestaltet.