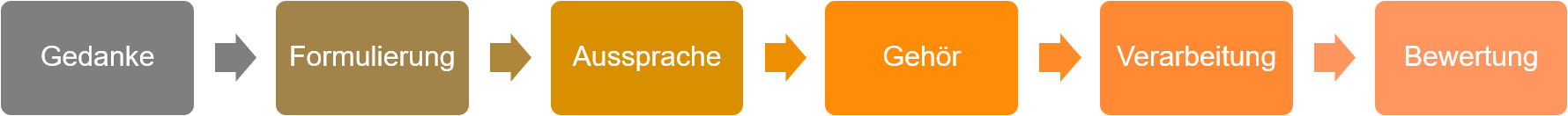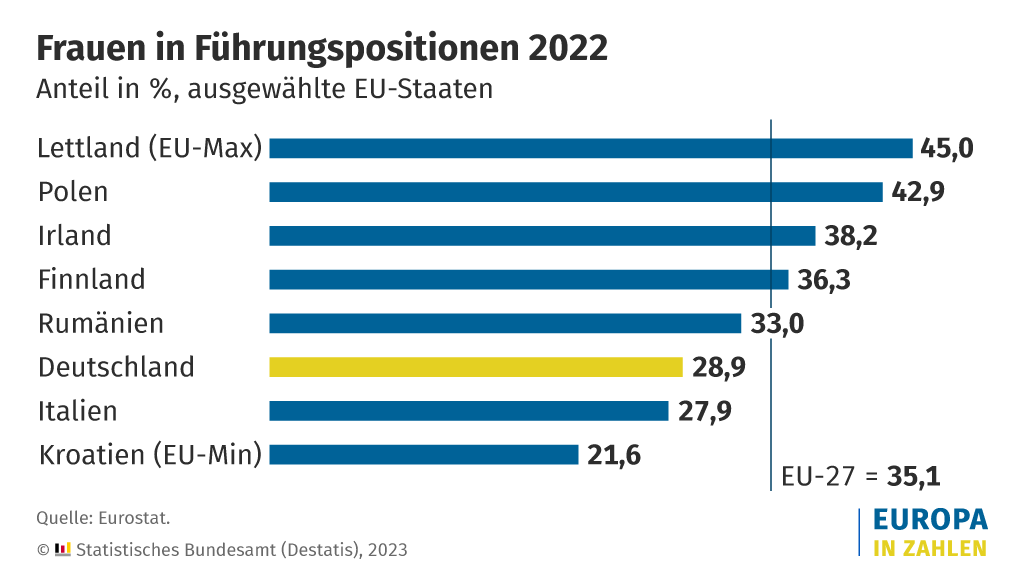Meine Kindheit verlebte ich in einem kleinen Dorf in den Südstaaten der Bundesrepublik. Rassismus war erstmal weniger ein Thema. Meine kindlichen Kontakte zu Menschen einer anderen Ethnie beschränkten sich auf einen Türken in meiner Grundschule, Yakup, einen Italiener in meiner Straße, Mathias, und einen Schwarzen, Chico, in unserem Dorf. Mit Yakup in der Grundschule bestand eine gewisse Irritation. Seine Kleidung war anders und er sprach nur schlecht oder gar nicht deutsch. Mathias war von einem indigenen deutschen Kind nur schwer zu unterscheiden. Bei Chico war der Unterschied für alle sichtbar.
Der dörfliche Störenfried meiner Generation fand dann auch immer die richtigen, also falschen, Beleidigungen. Ich war damals dann etwas naiv irritiert, warum ich die Hautfarbe nicht zum Gegenstand einer Beleidigung machen durfte, wohl aber Größe (du Zwerg), Umfang (Speckwampe) oder geistige Kapazität (Dummkopf). Außerdem war es für mich normal, dass es Schwarze gab und beim täglichen Rollenspielen mit Freunden wählte sich jeder auch ab und an einen Schwarzen aus dem damaligen Cartoon Programm, den er dann mehr oder weniger darstellte, als wir durch Wald und über Felder tobten.
Meine Mutter erklärte mir das Konzept, dass man das nicht mache, einen Schwarzen „Choko-Crossie“ zu nennen. Das sei rassistisch. Ich akzeptierte es und von da an war es tabu, die Hautfarbe oder Herkunft in Beleidigungen einzubauen. Zudem blickte ich zu Chico auf, er war älter, größer und irgendwie cool. Aber was ist denn nun Rassismus?
Der Begriff der Rasse
Als Erstes stolpert man über den Begriff „Rasse“. Dem Zeitgeist entsprechend gibt es keine Rassen beim Menschen. Nun führt uns das aber nicht weiter. Denn es gibt eindeutige phänotypische (äußere) Merkmale, die Menschen unterschiedlicher Abstammung klar kategorisierbar machen. Ein Japaner sieht eben aus wie ein Japaner und nicht wie eine Aborigine (australischer Ureinwohner).
Darüber hinaus gibt es auch klare genetische Unterschiede, die vom Erbgut abhängen. Laktoseintoleranz hat in Europa einen Anteil von ca. 30 % in Asien liegt der Anteil bei ca. 70 %. Also versucht der Begriff „Rasse“ nur eine Bezeichnung für die Kategorie zu finden, in die wir Menschen anhand ihrer offensichtlichen Abstammung zuordnen können.
An anderer Stelle werde ich mich noch mit Pinkers Euphemismus Tretmühle beschäftigen. Wir können also den Begriff der „Rasse“ ersetzen durch Ethnie oder Volk oder Abstammungsgemeinschaft oder andere Begriffe. Der Tatsache, dass eine klare Benennung der Kategorie notwendig ist, entkommen wir so nicht. Um dem Begriff des „Rassismus“ treu zu bleiben, nutze ich im Weiteren auch den Begriff „Rasse“.
Das Merkmal der “Rasse” (meist die Haut- und Haarfarbe sowie der Knorpel- und Knochenwuchs im Gesicht) wird bei Rassismus herangezogen, um Zugehörige einer anderen Rasse herabzuwerten. Dazu werden unterschiedlichen Rassen unterschiedliche Eigenschaften quasi genetisch zugeordnet, denen das einzelne Individuum dann nicht entkommen kann.
Moderne Definition von Rassismus
In der jüngsten Zeit hat sich in diese Definition aber der postmoderne, neomarxistische Zeitgeist eingeschlichen. Entscheidend für Rassismus ist neben der ethnischen Herkunft, die Stellung der Gruppierung in der Gesellschaft. Nur gegen Minderheiten kann Rassismus existieren. Die Definition der Amadeu Antonio Stiftung sieht zum Beispiel vor, dass nur nicht-weiße Menschen oder offensichtlich nicht-Deutsche Menschen Opfer von Rassismus werden können. Eine steile These. Nach dieser Definition wird es schwierig, rassistische Ereignisse in der jüngeren deutschen Vergangenheit auch als Rassismus einzuordnen.
Viele Juden im dritten Reich sahen sich als Deutsche und waren sogar ausgemachte Patrioten und teilweise Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg. Das war unter anderen auch ein Grund für so manchen, Deutschland nicht zu verlassen. Es geht bei dieser modernen Definition darum, weg von individuellen Rechten zu kommen, die im Grundgesetz schon verankert sind, hin zu Rechten für Gruppen und Identitätspolitik. Dabei ist die Debatte stark von den USA beeinflusst. Man liest selbst bei der deutschen Antidiskriminierungsstelle immer von PoC oder People of Colour. Und in den USA wird der heutige Rassismus gegen Schwarze mit der Sklaverei begründet.
Aber was hat speziell die Sklaverei mit Rassismus zu tun? Nun, der offensichtliche oder zumindest scheinbar offensichtliche Zusammenhang ist der, dass die weißen Menschen die, als untergeordnet wahrgenommenen, schwarzen Menschen versklavt haben. Also der Grund für die Versklavung, oder einer der Hauptgründe, war der Rassismus.
Überblick Sklaverei
Gehen wir kurz ein bisschen genauer auf die Sklaverei ein, bevor wir wieder auf den Zusammenhang mit Rassismus zurückkommen. Seit Anbeginn der Zivilisation waren die Gesellschaften stark hierarchisch organisiert. An der Spitze stand ein Häuptling, König oder Kaiser, danach folgten meist die Jäger, Krieger oder Ritter, später noch anderes Stände, wie Handwerker, Händler, Bauern und Bürger und ganz unten fand man die Sklaven. Dabei spielte Hautfarbe keine Rolle. Die Mobilität der damaligen Bevölkerung war so gering, dass eine Migration über die“Hautfarbengrenze“ hinaus die absolute Ausnahme darstellte.
Schwarz versklavte Schwarz, Weiß versklavte Weiß und so weiter. Der Begriff Sklave leitet sich tatsächlich vom Volk der Slaven ab. Es gab auch wenig bis keine Versuche der Philosophen, Propheten oder Priester, die Sklaverei in irgendeiner Form moralisch zu rechtfertigen, außer Aristoteles vielleicht. Es war einfach normal, dass Menschen nicht gleich waren und eben einige ganz unten und andere ganz oben waren. Ein Auf- oder Abstieg war möglich, jedoch schwierig und sehr selten. Vor allem der Aufstieg, der Abstieg, auch zum Sklaven, war leichter. Die Vorstellung „Ich habe gewonnen, könnte dich jetzt töten, tue es aber nicht, und deswegen gehörst du jetzt mir“, entbehrt ja auch nicht einer gewissen barbarischen Logik.
Die ersten Versuche, die Sklaverei zu rechtfertigen, stammen aus dem Süden der Vereinigten Staaten. Ab dem 16ten Jahrhundert wurden Sklaven aus Westafrika in die Amerikas verschifft. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es keinesfalls die Weißen waren, die afrikanischen Boden betraten, dort Sklaven jagten, und diese dann verschifften. Es dauerte noch bis ins 19te Jahrhundert, bis Weiße Afrika sicher betreten konnten, ohne binnen wenigen Wochen an Malaria oder anderen Tropenkrankheiten einzugehen.
Vielmehr gingen die Schiffe weit vor der Küste vor Anker, da es keine schiffbaren Häfen in Westafrika gab, und setzten in Booten über. Am Strand fand dann der Handel mit den ebenfalls schwarzen Händler statt. Viele afrikanische Völker bauten ihren Wohlstand auf der Sklavenjagd und dem Sklavenhandel auf, wie z.B. das Königreich Dahomey oder Benin. Von den in die Amerikas verschifften Sklaven gingen knapp 40 % nach Brasilien, 35 % auf die karibischen Inseln, 18 % nach Mittelamerika und der kleinste Teil mit knapp 10 % nach Nordamerika auf die Plantagen der Südstaaten. Insgesamt geht man von ca. 12 Mio. Sklaven aus, die auf diesem Wege verschifft wurden. Der kleinste Teil davon in die Südstaaten.
Wenn es um Rassismus gegen Schwarze geht, sprechen wir aber nicht über die Regionen, die den meisten Anteil der verschleppten Westafrikaner abbekamen, wie Brasilien oder die karibischen Inseln. Wir sprechen immer nur von den Südstaaten der USA, die doch nur 10 % der Sklaven erhielten, also in Summe wahrscheinlich etwas mehr als 1 Mio. Menschen über einen Zeitraum von über 200 Jahren. Warum ist das so?
Zusammenhang Sklaverei und Rassismus
Thomas Sowell liefert eine Erklärung in seinem Buch „Black Rednecks and White Liberals“. Die Sklaven in den Südstaaten trafen ab 1776 auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Diese besagt klar: “all men are created equal”, alle Menschen sind gleich erschaffen. Keine der anderen Nationen, die westafrikanische Sklaven aufnahmen, war eine Demokratie oder gestand seinen Einwohner individuelle Rechte in einem solchen Ausmaß zu. Es entstand also in den USA zum ersten Mal in der Geschichte die Situation, die es notwendig machte, die Sklaverei moralisch zu begründen.
Die einzige Lösung Sklaverei und “alle Menschen sind gleich” unter einen Hut zu bringen war: Sklaven (in den USA fast ausschließlich Schwarze) sind keine wirklichen Menschen. Damit war ein wichtiger Baustein für den biologischen Rassismus gelegt. Die Vorstellung, es gäbe echte Menschen und niedere Rassen. Aufbauend auf dieser Grundlage wurden diese Vorstellungen Anfang des 20. Jahrhunderts weiter verfolgt und führten zu noch mehr Gräuel.
Somit ist also nicht der Rassismus die Ursache für die Sklaverei in den USA, sondern, wenn dann, eher umgekehrt. Erst das Aufeinandertreffen der jahrtausendealten Unsitte der Sklaverei und modernen Menschenrechten in ihren ersten Zügen gebar das Ungetüm Rassismus.
Wie sieht es heute mit der Sklaverei aus? Leider schlimm. Heute gehen wir davon aus, dass es weltweit noch 40 Mio. Menschen gibt, die in Sklaverei leben, davon ca. 18 % in Subsahara Afrika (Schwarze versklaven Schwarze). Menschenhandel blüht. Der Sklavenmarkt von heute findet allerdings nicht mehr im Sand der westafrikanischen Strände statt, sondern oft im Netz. Speziell Kinder sind davon betroffen. Als Sexarbeiter oder Kindersoldaten müssen sie auch heute noch die Schrecken der Sklaverei ertragen.
Wir sollten uns also weniger darauf konzentrieren, den Westen für seine Gräuel zur Verantwortung zu zeihen, denn es war der Westen, allen voran Großbritannien, die dieser Unsitte zumindest im Westen ein Ende bereitet hatte. Wir sollten uns stattdessen auf die Gegenden konzentrieren, in denen noch heute Menschen geraubt und als Sklaven gehalten werden. Und, um es mit Morgan Freeman zu halten, wir sollten aufhören über Rassismus zu reden und davon absehen eine Opfermentalität zu kultivieren.